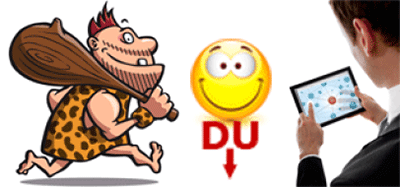Ein Schuss Männlichkeit - Waffen gegen Angst
Eine nicht zu verkennende Anspielung auf den technologischen Fortschritt, der sich im ständigen Wandel befindet: größer, stärker, besser – der aber auch nach hinten losgehen kann. Macht man sich auf die Suche nach einer Antwort, so hat die Evolution jedenfalls auch hierfür eine Erklärungsmöglichkeit anzubieten.Verteidigung und Jagdtrieb
Machen wir einen Sprung in die Steinzeit. Damals sicherten Waffen den Fortbestand der Sippe. Sie dienten der Nahrungsbeschaffung wie auch der Verteidigung. Wild konnte erlegt werden - nicht nur aus unmittelbarer Distanz, sondern mit der Entdeckung von Schusswaffen schließlich auch aus weiterer Entfernung. Männer mussten sich „typisch maskulin” geben. Indem sie sich aggressives Verhalten aneigneten, konnten sie Feinde und Opfer einschüchtern und sicherten das Überleben ihrer Gruppe. Verstärkter Waffengebrauch war dabei äußerst hilfreich. Körperliche Unterlegenheit bedeutete fortan nämlich nicht mehr einen leeren Teller oder Prügel. Was dem Körper fehlte, konnte durch Waffen ausgeglichen werden. Ein Instrument der Macht, das im Laufe der Zeit mehr und mehr zu einem Statussymbol wurde - es markierte den sozialen Status ihres Trägers innerhalb der Gesellschaft. Auch heute noch zählt in manchen Kulturen das Tragen einer Waffe als Zeichen der Männlichkeit. Im Jemen werde die so genannten „Janbiyas“, kunstvoll verzierte Krummdolche, Stolz zur Schau getragen. Knaben, die aus dem Kindesalter heraus sind, erhalten zu ihrem Eintritt in die Männlichkeit einen solchen Dolch.
Fortschritt durch Technik?
Jenseits der Traditionen steht vor allem die Technik der Waffen im Vordergrund. Technik fasziniert Männer - ein gesellschaftliches Rollenbild, in das man oft auch geboren wird, ohne darauf drängen zu müssen. Fortgeschrittene Technik ist ein Zeichen einer fortgeschrittenen Gesellschaft. Und je besser die Waffen, desto besser können territoriale Ansprüche geltend gemacht werden. Technik und Herrschaft ziehen an einem Strang. Das Wettrüsten könnte diesen Strang jedoch schnell durchtrennen - und zur eingangs erwähnten einsteinigen Steinzeit führen.
Vom Säbelzahntiger zur Spinne
Unmittelbar mit den Waffen in Verbindung steht die Angst. In der Steinzeit war es die Angst vor Feinden und Tieren. Und manches Getier lässt auch heute noch ein mulmiges Gefühl aufkommen, das in einer unangenehmen Phobie enden kann.
Eine der am weitesten verbreiteten Tierphobien ist die Angst vor den acht-beinigen Krabbeltieren - den Spinnen. Betroffene gehen dabei sogar so weit, ihren Lebensstil nach den Tieren zu richten und sich mal nicht ins Grüne zu begeben, nicht das Fenster zu öffnen oder den Gang in den Keller zu vermeiden. Gerade wer unter Spinnenangst leidet, besitzt die besondere Gabe, Spinnen schon um einiges früher als die übrigen Menschen erkennen zu können, was uns das erst einmal irrational erscheinende Verhalten schon wieder einigermaßen erklären könnte. Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass hier eine angeeignete Urangst am Werk sein könnte. Menschen mussten sich seit Anbeginn vor tödlichen und aggressiven Tieren hüten. Die Angst davor ließ sie nun weit aufmerksamer auf drohende Gefahren reagieren und die verfrühte Flucht ließ ihre Überlebenschancen gleich um einiges steigen.
Fürchtet euch, habt Angst!
Es ist dies eine emotionale Reaktion, die uns generell zeigt, dass Angst dabei hilft, Gefahren rechtzeitig erkennen zu können. Im Fall der Spinnen ist schließlich nicht das Spinnengift der Auslöser der Furcht sondern vielmehr das Aussehen. Ob die Angst nun vererbt oder erlernt sei - darüber herrscht noch Unstimmigkeit. Gegen die Lerntheorie spricht jedoch, wie Untersuchungen gezeigt haben, dass etwa Schlangenphobien vor allem in solchen Gebieten verbreitet sind, in denen Schlangen seltener vorkommen. Es fehlt also an schlechter Erfahrung.
Jetzt wird’s eng
Auch nicht viel angenehmer ist die so genannte Klaustrophobie - die Angst vor geschlossenen oder engen Räumen. Dabei bleibt Betroffenen schon beim Betreten von Aufzügen die Luft weg.
Wie auch bei der Tierphobie, spielen sich hier actionreiche Szenen im menschlichen Nervensystem ab. Zentrum der Emotionsverarbeitung im Hirn ist die „Amygdala“ - auch „Mandelkern“ genannt. Von hier aus werden Stresshormone wie Cortisol oder Noradrenalin in den Körper gepumpt und drängen den Körper auf eine Reaktion: Flucht! Auch wenn keine unmittelbare Gefahr droht.
Im Falle der Klaustrophobie sehen Psychologen eine mögliche Erklärung wieder einmal in der Steinzeit. Der Ansatz ist eher indirekt. Früher mussten sich die jagenden Menschen in dunklen Höhlen vor Säbelzahntigern und ähnlichem Ehrfurcht einflößendem Getier fürchten. Die Furcht sicherte ihr Überleben und prägte das Verhalten so weit gehend, dass auch heute noch in engen, dunklen Räumen Urängste erwachen und am Nervenkostüm kratzen.
Was dagegen helfen kann? Wiederholte Konfrontation und die darauf folgende Erkenntnis, dass die vorab empfundene Gefahr bloß ein Wink der Einbildung ist. Und sich ständig einreden: „Säbelzahntiger gibt es nicht, Säbelzahntiger gibt es nicht, Säbelzahntiger...”.
Autor: Mag. Oliver Rapouch
Teilen
| Kommentare | ||
| Kommentar schreiben | ||