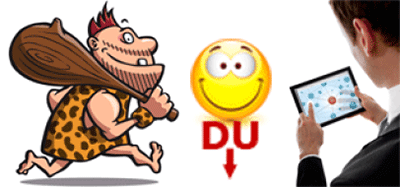Evolution im Vor- und Rückwärtsgang
Die menschliche Haut im Zeichen der Gans
Fangen wir einmal bei dem größten Organ des Menschen an - der Haut. Jeder kennt es: wenn wir Schaudern oder Kälte verspüren, zeigt sich auch die Haut nicht unbeeindruckt. Unzählige kleine Erhebungen geben zu erkennen, dass die momentan durchlebte Situation für uns nichts Alltägliches ist - Gänsehaut!
Welcher Sinn sich dahinter versteckt, lässt sich ganz gut mit einem Ausflug in die Tierwelt erklären. Nehmen wir die Katze als Beispiel. Wenn Gefahr droht, stellt sie ihr Fell auf und macht sich damit - zumindest optisch - um ein ganzes Stückchen größer. Muskelzellen im Haaransatz sorgen dafür, dass auch der kleinste Stubentiger plötzlich wie ein reißender Löwe dasteht - bedrohlich und groß.
Doch auch Kälte bringt uns den Gänsen näher. Der Grund: Wenn sich die Haare aufrichten, dient die Luft, die dazwischen liegt, als Isolationsmaterial. Also je dichter die Haarpracht, desto mehr Luft, desto mehr Isolation, desto mehr Wärme wird gespeichert.
Da der Mensch heutzutage in den meisten Fällen auf ein ganzkörperliches Haarkleid verzichtet, Werwölfe mal ausgenommen, ist auch die Aufgabe der Gänsehaut etwas, das mehr in die Vergangenheit gehört.
Von weisen Zähnen und blinden Därmen
Die Funktion der Weisheitszähne beschränkte sich ursprünglich nicht allein darauf, irgendwann einmal gezogen zu werden. In einer Zeit, in der vor allem rohes Fleisch auf dem Speiseplan stand, war der hungrige Mensch für jedes zusätzliche Mahlwerkzeug dankbar.
Doch hin und wieder musste auch auf Pflanzen zurück gegriffen werden. Und hier - so vermutet man - sprang dann wohl der Blinddarm helfend ein. Wenn er auch heute nicht mehr für schwer verdauliche Nahrung zuständig ist, so erfüllt er doch noch eine nicht unbedeutende Rolle. Die Rolle eines Bakterienreservoirs und Unterstützers des lymphatischen Abwehrsystems. In entwickelten Ländern mit guten Hygienestandards wird diese Funktion allerdings in der Regel nicht mehr benötigt.
Brustwarzen für alle - Über „man boobs” und stillende Männer
Über die Brustwarzen werden Neugeborene mit ihrer wichtigsten Nahrung versorgt - Muttermilch. Doch weshalb verfügt dann der männliche Körper ebenfalls über derartiges Zubehör? Die Antwort liegt im Embryonalstadium. In dieser frühen Phase des Lebens gibt es noch keine Geschlechterteilung. Erst wenn das Y-Chromosom zum Tragen kommt und für einen Testosteronschub sorgt, wird die Entwicklung eines männlichen Phänotyps in die Wege geleitet. Auch wenn das Brustgewebe hier schon besteht, wird das Wachstum jedoch eingeschränkt. Die Brustwarzen bleiben allerdings bestehen.
Aufgrund von Störungen im Hormonhaushalt - hervorgerufen durch Krankheiten wie die Gynäkomastie (eine Vergrößerung der Brust des Mannes) oder als Nebenwirkung bestimmter Medikamente - kann sich die männliche Brust auch schon mal der weiblichen Form anpassen. Aus einer pharmazeutischen Fabrik in Mittelamerika ist ein Fall bekannt, dass Arbeitern in der Verpackungsstätte einer Antibabypille plötzlich Brüste wuchsen. Warum? Sie atmeten den Pillenstaub ein, der seinerzeit noch sehr hoch dosiert war.
Unter Extrembedingungen ist der männliche Körper selbst dazu imstande, Säuglingsmilch zu produzieren. Extreme Unterernährung regt die Hormon-bildende Fähigkeit von Drüsen an und beeinträchtigt zugleich die Leber, die für gewöhnlich Hormone absorbiert.
Doch eines bleibt gewiss: Als erogene Zone haben Brustwarzen auch auf dem männlichen Körper immer noch ihre Berechtigung.
Etwas weiter unterhalb finden wir ein Überbleibsel aus der Zeit der Baumabenteuer. Affen benötigten ihren Schwanz zur Stabilisierung beim Klettern. Da der Mensch immer weniger seine Zelte auf den Bäumen aufschlug und sich vielmehr dem Boden verschrieb, brauchte er diesen Auswuchs über dem Gesäß nicht mehr. Das Steißbein ist alles, was übrig blieb und gibt uns heute zu erkennen, welches Naheverhältnis zwischen Affen und Menschen besteht.
Gähnen - eine Wohltat für das Hirn mit Ansteckungsgefahr
Oft ist es ein Zeichen von Müdigkeit oder Langeweile: das Gähnen. Doch haben Forscher an der State University of New York at Albany heraus gefunden, dass wir hier ebenso von einer Wärmetauschfunktion ausgehen können. In „heißen” Gehirnphasen sorgt das Gähnen für eine Temperaturregulierung, indem es die Versorgung mit kühler Luft sicher stellt. Wir gähnen also in stressigen Situationen oder in einem Stadium, das Konzentration erfordert, um das angestrengte Gehirn zu kühlen.
Was die „ansteckende” Wirkung des Gähnens angeht, müssen wir wieder einen Sprung rückwärts in der Evolution machen. Als der Mensch noch im Rudel lebte und grundsätzlich von jeder Seite ständig Gefahr drohte, hatte das Gähnen einen kollektiven Nutzen. Durch das gemeinsame Gähnen wurde für erhöhte Aufmerksamkeit in der Gruppe gesorgt, um durch die gesteigerte Hirntätigkeit besser auf drohende Gefahren gerüstet zu sein. Im Sinne von „Passt auf, ich habe etwas gehört!” Diese Theorie ist bis heute zwar nicht wissenschaftlich bewiesen, doch erscheint sie durchaus glaubhaft, wenn man Hunde beobachtet, die in Stresssituationen einfach mal ein Gähnen von sich geben.
Hören, was um die Ecke kommt
Nicht jeder Mensch verfügt über die Fähigkeit, mit den Ohren zu wackeln. Doch einige sind in dieser rudimentären Bewegung durchaus geübt. Sinn macht es heute nicht mehr, denn die Zivilisation befreite uns von der ständigen Alarmbereitschaft und führte in den meisten Fällen zu einer Rückbildung der Ohrenmuskulatur. Ähnlich wie bei Hunden und Katzen konnten die frühmenschlichen Vorfahren ihre Ohren in unterschiedliche Richtungen bewegen, um Geräusche wahrzunehmen - Geräusche, die Gefahr bedeuteten oder auch solche, die dem Jäger ein Festmahl versprachen.
Wir können die Steinzeit schwer aus den Gliedern vertreiben. Dass wir damit leben können, haben wir aber schon lange - teils unbewusst - bewiesen.
Autor: Mag. Oliver Rapouch
Teilen
| Kommentare | ||
| Kommentar schreiben | ||