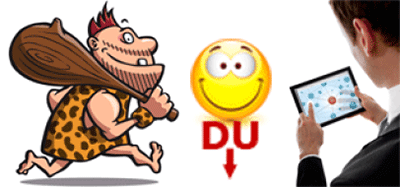Ernährung: Zurück zu den Wurzeln
Eine Ernährung, die nicht unbedingt von gestern ist
Mediziner der renommierten Mayo Clinic in Minnesota möchten mit dem Vorurteil aufräumen, dass unsere Urahnen unterernährte Mängelsammler gewesen wären. Im Gegenteil - der Speiseplan soll seinerzeit noch ausgewogener und besser auf die Lebenssituation abgestimmt gewesen sein als er es heutzutage wäre.
Auf unserem Weg zur idealen Ernährung sollten wir demnach einen Ausflug in die graue Vorzeit machen und die Vorfahren zum Vorbild nehmen. Auf deren Speiseplan standen wilde, unbehandelte Nahrungsmittel - Nahrungsmittel von natürlicher Reinheit also: viel frisches Obst und Gemüse, dazu Nüsse, Beeren, Wurzeln und Pilze, sowie Fleisch von Wildtieren und Wildfische. Das Resultat: eine hohe Menge an magerem Protein, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Vitaminen und Mineralien.
Unsere Ahnen hatten also im Vergleich zur heutigen Ernährung eine zwei- bis dreimal so hohe Ballaststoffversorgung, die doppelte Menge mehrfach ungesättigter Fettsäuren, einen vier mal höheren Omega-Fettsäuren-Spiegel und eine bis zu drei Mal höhere Proteinversorgung. Von raffinierten Getreideprodukten sahen die Steinzeitmägen so gut wie gar nichts.
Zurück zu den Wurzeln
Historische und anthropologische Untersuchungen haben gezeigt, dass die Menschen der Urzeit über gute körperliche Fitness verfügten und von Herz-Kreislauf-Erkrankungen noch nicht einmal etwas gehört hatten. Schließlich waren sie ständig in Bewegung - auf der Jagd bzw. auf der Suche nach Beeren und Nüssen und allem, was in ihren Augen eben essbar war. Weite Strecken mussten sie auf sich nehmen, um am Ende des Tages möglichst etwas auf dem Teller zu haben. Heute müssen wir unser Essen nicht mehr selber aufspüren und erlegen, kommen mit relativ wenig Bewegung durch den Tag, konsumieren weniger frisches Obst und Gemüse und dafür umso mehr an künstlich verarbeiteten Nahrungsmitteln.
Als die Wildtiere den Speiseplan verließen
Einen entscheidenden Wendepunkt brachte die Entdeckung der Landwirtschaft - Tiere mussten nun nicht mehr gejagt und Früchte nicht mehr gesucht werden. Wildtiere verschwanden immer mehr vom Speiseplan und die Zeit der weiterverarbeiteten Getreideprodukte brach an. Weniger Natürlichkeit. Weniger Bewegung. Doch von jetzt an musste der Mensch weniger Angst haben, am Ende des Tages den Gesängen des leeren Magens lauschen zu müssen.
Dass einseitige Ernährung für das Überleben nicht die perfekte Wahl war, zeigte - laut Archäologen der Washington University - der Neandertaler, der auf Rotwild, Rentiere und Mammuts spezialisiert gewesen sein soll. Es war dann schließlich nicht nur die schwierige Jagd, sondern vor allem die Wildtierknappheit, die ihm letztendlich zum Verhängnis wurde. Seine Nachfolger setzten viel Fisch und Meeresvögel auf ihre Speisepläne. Diese lieferten ihnen mehr Eiweiß, was für das Überleben in kälteren Regionen überlebensnotwendig war. Zudem waren sie nicht mehr auf Großwild angewiesen, kannten einen Weg, die Fische zu trocknen und so haltbarer zu machen – als Reserve für schlechte Zeiten. Einige Wissenschaftler vertreten außerdem die Theorie, dass die fischreiche Ernährung mit bestimmten Fettsäuren ihr Gutes für die Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns getan habe. Fischen fürs Wissen.
Die süße Sucht
Auch die Lust auf Süßes führt auf klebrigen Spuren zurück in die Steinzeit. Einst mussten sich unsere Vorfahren vom Geschmack leiten lassen, um zu wissen, was sich gut auf dem Teller mache. Bitter war oft ein Zeichen dafür, dass etwas giftig sei, während Säuerliches Unreife signalisierte oder dass etwas bereits am Verderben war. Süßes hingegen, zauberte ein Lächeln auf die Lippen. Süße, reife Früchte zeigten, dass es Vitamine zu holen gab. Außerdem wusste der Steinzeitmensch: etwas Süßes brächte auch Kalorien in Form von Kohlenhydraten und diese waren perfekt als Reserve für schlechte Zeiten. Daher reagierte der Körper auch mit Wohlgefallen und nahm dankbar an - selbst wenn der Sättigungsgrad bereits erreicht war. Unser heutiger Heißhunger auf allerlei Zuckriges kann also als eine Reminiszenz an die alten Tage gezählt werden, als Schokolade noch nicht aus allen Regalen wuchs.
Ähnlich verhält es sich mit fetten Speisen. Denn auch Fett war früher notwendig, als die Winter noch eine große Herausforderung für das Überleben waren.
Die ständige Unsicherheit, möglicherweise nicht genügend zwischen die Zähne zu bekommen, führte oft zu einem Leben auf Sparflamme. Doch wenn sich einmal die Möglichkeit bot, langte man schließlich doch ordentlich zu. So geschehen, wenn etwa eine Jagd erfolgreich zu Ende gegangen war. Und auch heute noch schlägt sich der moderne Mensch steinzeitlich den Bauch voll, wenn etwa eine Feier auf dem Programm steht. Dann kann es auch schnell mal passieren, dass die Völlerei einem die körperlichen Grenzen aufzeigt und sagt: „Nichts geht mehr!”
Die schützende Hand des Ekels
Eine weitere Möglichkeit, den Körper vor übermäßigem Verzehr zu warnen, ist das Gefühl des Ekels - evolutionsbiologisch sinnvoll, wenn sich etwa zu viele Giftstoffe in der Speise angesammelt haben. Wenn wir etwas Verdorbenes zu uns nehmen, spüren Sensoren im Verdauungstrakt die Giftstoffe auf und leiten chemische „Brechmittel” ein, um den Körper von diesen Toxinen zu befreien - Übelkeit und Erbrechen sind die Folgen. Evolutionsbiologen gehen von einem Selbstschutzmechanismus aus, der zugleich auch auf einen Lerneffekt setzt - der Betroffene assoziiert die Speise fortan mit Ekelgefühlen und lässt zukünftig die Finger davon.
Ein cleverer Schachzug der Natur also, um uns vor uns selbst und unserem blinden Heißhunger zu schützen. Nicht übel, dieser Ekel.
Autor: Mag. Oliver Rapouch
Teilen
| Kommentare | ||
| Kommentar schreiben | ||